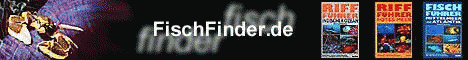 |
 |
| Das Rätsel um die Riesenwellen |
Nicht erst seit den einschlägigen Kinoereignissen stehen sie als Synonym für Verwüstung, Chaos und Tod. Sie heißen Riesenwellen, Monsterwellen, Tsunamis, oder Freakwaves. Wenn sie über Küsten hereinbrechen, bringen sie den Tod für Hunderttausende, zerstören ganze Städte und tragen deren Schutt bis weit in das Hinterland. |
||
|
Dass Erdbebenstöße und tektonische Bewegungen auf dem Meeresgrund Monsterwellen auslösen können, die sich bei Grundberührung in dem relativ flachen Wasser nahe der Küste zu großen Höhen aufsteilen können, ist eine Binsenweisheit.
Gerade im Pazifikraum werden bis zu 40 Meter hohe Riesenwellen von Vulkanausbrüchen und Seebeben ausgelöst. Allzu oft sind zum Beispiel die Küsten Japans in den vergangenen Jahrhunderten von solchen Tsunamis heimgesucht worden. Auch die Hawaii-Inselgruppe mitten im Pazifik wurde im Laufe der vergangenen hundert Jahre 13 Mal von Freakwellen erschüttert. Solche durch geotektonischen Vorgänge ausgelösten Riesenwellen können Schiffen in tiefem Wasser in der Regel nichts anhaben. Mit Geschwindigkeiten von bis zu 700 Kilometern pro Stunde rasen sie über das offene Meer, ohne nenneswerte Spuren auf der Wasseroberfläche zu hinterlassen. Ihr Orbitalradius erreicht den Meeresgrund nicht, und daher werden sie nicht gebremst und aufgesteilt. Im Gegenteil, bei Tsunamiwarnung heißt es für die Fischerboote im Hafen meistens: Leinen los und raus auf die offene See. Wie aber kommt es zu den Riesenwellen auf hoher See? Sind sie nur Seemannsgarn – Stoff für großes Kino und Abenteuerromane? Oder kommen sie nur alle Jahrhunderte einmal als Folge besonderer Umstände vor? Mitnichten, wie man heute weiß. Selbst Ozeanriesen sind nicht sicher Auch Ozeanriesen oder Erdölförderanlagen werden plötzlich und ohne Vorwarnung auf der offenen See getroffen, weit entfernt von den flachen Gewässern der Kontinentalschelfe. Wie Wände aus Glas erheben sich die Wassermassen und schlagen über dem Schiff zusammen. Ihre ungeheure Wucht zertrümmert Ladeluken und Kommandobrücken. Die elektronische Steuerung fällt aus, die Maschinen stehen still. Tonnen von Wasser dringen in die Laderäume, das Schiff kentert innerhalb weniger Minuten und verschwindet spurlos in der Tiefe. Die wenigsten werden je gefunden. Mindestens zehn schwere Schiffsunglücke – so schätzen die Wissenschaftler heute – gehen pro Jahr für auf das Konto der so genannten Monsterwellen. Und sie sind eben keine zufälligen und singulären Ausnahmeereignisse. Sie gehören vielmehr zum normalen Inventar meeresphysikalischer Dynamik, wie die Vielzahl der mittlerweile vorliegenden Indizien belegt. Wasserwände von bis zu 40 Metern Höhe sind dabei auch auf dem freien Ozean keine Seltenheit, warnen Wissenschaftler. Nun sind die neuesten Forschungsergebnisse ausgewertet und liegen offen. Im Rahmen des Forschungprojektes MaxWave haben Wissenschaftler des GKSS-Forschungszentrums in Geesthacht in den letzten Jahren tausende von Satellitenbildern ausgewertet. Demnach sind bestimmte Meeresgebiete auf der Erde für das Entstehen von Monsterwellen prädestiniert. Dort wo Strömungs-, Schichtungs und Wellenverhältnisse unterschiedlicher Wasserkörper entsprechend zusammenspielen, türmen sie sich ohne Vorwarnung auf und richten schwere Verwüstungen an, wenn sie auf Hindernisse stoßen. Anschließend und verschwinden sie genauso schnell und spurlos wieder in den Weiten das Ozeans. Zu diesen besonders gefährdeten Gebieten gehören neben dem schon berüchtigten Agulhas-Strom vor der Südostküste Südafrikas am Kap der Guten Hoffnung noch der Golf von Alaska, die Küstenmeere vor Florida und die See südöstlich des japanischen Archipels. Tsunamis über Deutschland? Aber auch im Nordatlantik oder in der Nordsee können Riesenwellen erheblichen Schaden anrichten. Aufgrund von Laserdaten konnte man die Höhe des Brechers, der am ersten Januar 1995 die Ölförderplattform Draupnir des norwegischen Staatskonzerns Statoil traf, mit 26 Metern angeben. Allein die bekannten Naturkräfte können Wellen von riesigen Ausmaßen erzeugen. Die aus dem Wechselspiel von Anziehungs- und Fliehkraften von Mond und Erde resultierenden Gezeitenwellen lösen unterschiedliche Tidenhübe in aller Welt aus. In der kanadischen Fundy Bay beträgt der Gezeitenhub bis zu 16 Metern Höhenunterschied, im Bereich der Nordsee liegt er zwischen einem und vier Metern. Die Gezeiten wirken sich aber nur an der Küste und unter bestimmten Umständen katastrophal aus – zum Beispiel als Sturmflut. Auf See ist es die Reibungskraft des Windes, die für Wellen und Seegang sorgt. Die Höhe der Meereswellen hängt hierbei direkt von der Stärke des Windes und die Dauer der Einwirkung auf die Wasseroberfläche ab. Stürme können auch so schon mal einzelne Brecher bis auf 20 Meter hoch treiben. Welche Art von Mechanik aber die riesenhaften Einzelwellen entstehen lässt, die sich scheinbar ohne äußere Einflüsse wie Sturm, Gezeiten oder Erdbeben aus dem Nichts bis auf 40 Metern Höhe aufbäumen und auf einer Breite von mehreren Kilometern über den offenen Ozean rasen, ist bis heute ein weitgehend ungelöstes Rätsel. In zahlreichen kombinierten Forschungsprojekten versuchen Wissenschaftler aus aller Welt, das Geheimnis der Monsterwellen zu entschlüsseln. Die Erkenntnisse sollen bei der Entwicklung von Überwachungs- und Frühwarnsystemen zum vorbeugenden Schutz von Schifffahrt und Offshore-Anlagen Anwendung finden. Konkrete Vorschläge für technische Verbesserungen sollen schon frühzeitig bei Planung und Bau von Schiffen, Offshore-Anlagen und Küstenschutzeinrichungen einfließen Führend bei der Erforschung dieses Phänomens ist zur Zeit die Europäische Union. Unermüdlich sammeln die MaxWave-Forscher um Wolfgang Rosenthal an der GKSS Geesthacht Messdaten aus allen Teilen der Welt und werten sie aus. Fieberhafte Forschungsaktivität Die MaxWave-Kampagne läuft seit einigen Jahren im Zusammenschluss von zehn Institutionen aus zehn Ländern. In koordinierten Einzelprojekten untersuchen sie Vorkommen, Häufigkeit und vor allem die Entstehungsmechanismen von Riesenwellen auf offener See. Ein weltweites Netz aus stationären und mobilen Lasern auf Offshore-Anlagen, Seegangsbojen und Schiffen liefern dabei wichtige Informationen über Wellenhäufigkeit und -höhe in bestimmten Seegebieten. Zudem übermittelte ein besonderes Radarsystem an Bord europäischen Forschungssatelliten ERS-2 innerhalb von drei Wochen allein 30.000 Überwachungsbilder aus dem Weltraum. Besonders das neuartige Wellenradarsystem WaMos (Wave Monitoring System) leistete bei der Feldarbeit wichtige Dienste. Das Gerät kann an Bord jeden Schiffes montiert werden und ist in der Lage, Wellenbilder in Folgen von bis zu 32 Aufnahmen pro Minute zu erstellen. Die Auswertung der Bildfolgen liefert grundlegende Daten über die Höhe,Verteilung, Frequenz, sowie Gruppierung und Richtung von Wellen in einem Seegebiet. Ein Hauptarbeitsgebiet der MaxWave- Forschung bildete der Agulhas Strom am Kap der Guten Hoffnung vor Südafrika. Vor zehn Jahren wies der südafrikanische Mathematiker Marius Gerber von der Stellenbosch University in Kapstadt mathematisch nach, dass es unter den besonderen Stömungsverhältnissen im Bereich des Agulhas Stromes zu speziellen Formen der Überlagerung und Konzentration von Wellen kommen kann. Diese südgrichtete Meeresströmung prallt bei entsprechender Wetterlage im Bereich des Kaps fast frontal mit etwa von zweieinhalb Metern pro Sekunde auf Sturmwellen aus dem Atlantik oder dem Südpolarmeer. Dabei verringert sich die Länge der gegenläufigen Wellen. Die Sturmwellen werden komprimiert, aufgesteilt und abgelenkt: beste Vorausetzungen für die Geburt von Monsterwellen. Der kombinierte Prozess aus Wellenüberlagerung und Richtungsänderungen in definierten Bereichen einer Strömung soll auch in anderen Regionen der Welt – etwa auch im Bereich des nordatlantischen Golfstromes – Riesenwellen formen können. Interferenzen und die Überlagerungen von Schwingungsfrquenzen können also auch Meereswellen auslöschen oder verstärken. Zwar konnten die GKSS-Forscher nun Gerbers mathematische Studien unter anderem mit Hilfe von WaMOS verifizieren. Doch noch immer gibt das Phänomen genügend Rätsel auf. Nicht nur die Überlagerung mehrerer "normaler" Wellen kann Riesenbrecher hervorrufen. Auch Wasserschichtung oder rätselhafte Wirbelfelder leisten ihren Beitrag. Zahlreiche Versuche im Wellenkanal können helfen, die einzelnen Ungereimtheiten aufzulösen. Mysteriöse Unglücksfälle Bis heute sind erst einige wenige grundlegende Erkenntnisse zusammen gekommen. Hochrechnungen aus den gewonnenen Daten ergaben zum Beispiel, dass auf etwa jede zehntausendste Einzelwelle eine so genannte Freakwave kommt. Auch konkrete Statistiken über das Auftreten von Riesenwellen liegen für einzelne Meeresgebiete schon seit geraumer Zeit vor. Kürzlich wurde eine Art von "Weltkarte der Riesenwellen" vorgestellt, die einen Überblick über deren weltweite Verteilung und Häufigkeit vermittelt. Die Daten zeichnen ein verblüffendes Bild: Dänische Radarstudien ermittelten allein für das Gorm- Ölfeld in der Nordsee 466 Riesenwellen im Laufe der vergangenen zwölf Jahre. Die Größte von ihnen im Jahre 1997 kam auf eine Höhe von 17,5 Metern. Bisher bekannte Wellentheorien liefern keinerlei Erklärung für eine derartige Häufung gerade in der Nordsee. Mittlerweile unterscheiden Ozeanografen verschiedene Arten von riesenhaften Einzelwellen. Die so genannte signifikante Wellenhöhe ist dabei die Ausschlag gebende Maßeinheit. Sie errechnet sich aus dem Durchschnittswert der 33 höchsten Wellen in einer Reihe von einhundert aufeinander folgenden. Wird dieser Mittelwert von einer Welle um das Doppelte überschritten, handelt es sich gemäß Definition um eine Freakwave oder Riesenwelle. Aber damit noch nicht genug. Insgesamt drei Sorten von Riesenwellen unterscheiden Meeresforscher je nach Ausbildung und Größe voneinander. Die einfachste Form der gewaltigen, plötzlich auftauchenden Riesenwelle mit unterschiedlicher Gestalt ist der Kaventsmann. Er übertrifft die normale signifikante Wellenhöhe um ein Vielfaches und kann sich auch in der Ostsee aufbauen. Die "MS Bremen" wird am 22. Februar 2001 mehrere hundert Meilen nordöstlich der Falkland-Inseln auf offener See von einem solchen Kaventsmann erwischt. Die 135 Passagiere an Bord kommen mit dem Schrecken davon, als die Welle von der Höhe eines zehnstöckigen Hauses den Luxusliner manövrierunfähig schlägt und das Schiff über eine halbe Stunde lang mit 40° Schlagseite zurück lässt. Nicht weit von dieser Stelle entfernt wird rund eine Woche später das Kreuzfahrschiff "Endeavour" auf halber Strecke zwischen den Falklands und Feuerland von einem weitern 35 Meter hohen Kaventsmann überrollt. Auch diesmal bleiben die Menschen an Bord unbeschadet. Drei tödliche Schwestern Die Drei Schwestern oder auch Three Sisters kommen schon per Definition niemals allein. Drei kurz aufeinander folgende Wellen, allesamt deutlich höher als die normalen Wellen, schlagen am 11. September 1995 über der "Queen Elizabeth II" auf ihrem Weg von Europa nach New York zusammen und nehmen dabei einen großen Teil ihrer Decksaufbauten mit über Bord. Als White Walls oder "Weiße Wände" schließlich werden extrem steile, fast senkrecht aufragende Einzelwellen bezeichnet, die in einer Breite von bis zu zehn Kilometern oder mehr über die offene See rasen. Im verhältnismäßig engen Golf von Biscaya tritt dieser Typ Riesenwelle häufiger auf. Seit sich das Interesse der physikalischen Ozeanografie verstärkt der Problematik um die Entstehung und Mechanik der Riesenwellen zuwendet, werden auch im Bereich der Schifffahrt einige Unfallstatistiken anders gelesen. Technische Prävention und die Einrichtung von Frühwarnsystemen kommen mehr und mehr auf die maritime Tagesordnung. In der Statistik von Lloyds Schiffsregister werden allein für das Jahr 2000 mindestens 81 von 167 gesunkenen Schiffen unter der Rubrik "Totalverluste bei schwerem Wetter" gelistet. Nach den jüngsten Forschungsergebnissen muss man heute annehmen, dass diese Schiffe von Riesenwellen versenkt worden sind. Mindestens 22 Schiffe von einer Länge über 200 Metern sind nach Ansicht einiger Ozeanografen in den vergangenen 30 Jahren durch Freakwaves zerstört worden. Das Unglück geht dabei so schnell vor sich, dass oft nicht einmal mehr Zeit für einen Notruf bleibt. Suche nach totaler Sicherheit So verschwand im September 1980 der 295 Meter lange Frachter "Derbyshire" vor der Küste Japans mit 44 Mann Besatzung ohne eine einzige Spur zu hinterlassen und ohne vorher SOS gefunkt haben zu können. Auch die wesentlich stabileren Offshore-Anlagen zur Ölgewinnung sind nicht restlos sicher. Am 15. Februar 1982 kenterte und versank die "Mobil Oil"-Förderplattform Ocean Ranger auf den Grand Banks von Neufundland, nachdem eine Riesenwelle die Komandozentrale überflutet hatte. Die gesamte Besatzung von 84 Mann fand den Tod. In Zukunft sollen Schiffe schon technisch besser auf derartige Begegnungen vorbereitet sein. Bisher werden Großschiffe und Ölplattformen noch nach Berechnungen geplant und gebaut, die von Belastungen ausgehen, die weit unter denen von Freakwaves liegen. Allein die Ausstattung von Massengutfrachtern mit stärkeren Ladeluken und die externe Anbringung von Fenstern der Kommandobrücken bei Kreuzfahrtschiffen und Fähren könnte das Risiko deutlich verringern helfen. Auch die weltweite Einführung eines funktionierenden Frühwarnsystem für Freakwaves scheint möglich zu sein. Immerhin ist mit der Entwicklung des WaMOS-Radarsystems ein erster Schritt getan. Doch noch muss hier Überzeugungsarbeit geleistet werden: viele Schiffseigner scheuen noch die Investition in die knapp 60.000 Euro teure Anlage. |
||